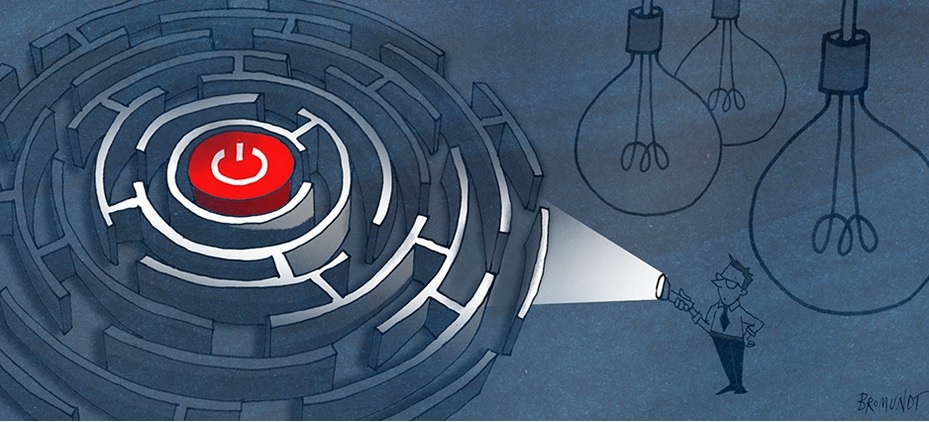Letzten Freitag hat das Bundesverwaltungsgericht den lange erwarteten Kartellrechtsentscheid in Sachen BMW veröffentlicht. Dabei wurde der vorinstanzliche Entscheid der Wettbewerbskommission bestätigt: Ein wichtiges Signal, das der Weko erlaubt, weiterhin gegen Gebietsabschottungen und die Verhinderung von Parallelimporten vorzugehen. Neben diesem wichtigen "politischen" Signal durften die Kartelljuristen auch mit Spannung erwarten, wie sich das Gericht zur Frage der "Erheblichkeit" äussern würde. Mit anderen Worten ging es bei BMW auch darum, ob ein Kartell schon allein wegen der Gebietsabschottung verboten werden kann oder ob auch negative Wirkungen im Markt tatsächlich nachgewiesen werden müssen. In diesem Punkt ist es dem Gericht leider nicht gelungen, eine Klärung herbeizuführen.
Mittlerweile sind drei Urteilsserien des Bundesverwaltungsgerichts ergangen, die sich ausführlich mit der Frage der "Erheblichkeit" auseinandersetzen. Die erste Serie war schon Gegenstand eines früheren Beitrags: Wir erinnern uns an die zwei Zahnpasta-Urteile (dazu hier im Blog) vom 19. Dezember 2013 (B-463/2010 i.S. Gebro Pharma GmbH und B-506/2010 i.S. Gaba International AG), in denen sich zur Erheblichkeit folgende Aussage findet:
“Zwar ist grundsätzlich die Erheblichkeit einer Abrede anhand qualitativer und quantitativer Kriterien zu bestimmen. Im vorliegenden Fall genügt allerdings bereits die qualitative Erheblichkeit, .... Wenn nämlich das Kartellgesetz selbst in Art. 5 Abs. 4 KG statuiert, dass solche Verbote vermutungsweise den Wettbewerb beseitigen, so ist a maiore ad minus grundsätzlich auch deren qualitative Erheblichkeit zu bejahen, unabhängig von allfälligen quantitativen Kriterien. Dies entspricht im Übrigen auch der Rechtslage in der Europäischen Union ... .”
Knapp ein Jahr später, am 23. September 2014, hat das Bundesverwaltungsgericht zwei weitere Urteile zu (horizontalen) Wettbewerbsabreden bei Baubeschlägen gefällt (B-8399/2010 i.S. Siegenia-Aubi AG und B-8404/2010 i.S. SFS unimarket AG). Zur "Erheblichkeit" macht das Urteil folgende Aussage, die quer zu den früheren Entscheiden steht:
“Im Zusammenhang mit der Frage nach dem rechtsgenüglichen Nachweis von bestehendem Restwettbewerb gilt es an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass im Gegensatz zur EU, in der seit dem 1. Mai 2004 auf Wettbewerbsbeschränkungen eine Verbotsgesetzgebung mit Legalausnahme Anwendung findet, in der Schweiz statt per se-Verboten eine Missbrauchsgesetzgebung gilt (...). Folglich hat die Vorinstanz de lege lata in jedem Einzelfall nachzuweisen, dass der Wettbewerb durch die fragliche Abrede erheblich beeinträchtigt wird. Zum heutigen Zeitpunkt besteht im schweizerischen Kartellrecht somit keine per se-Erheblichkeit, weshalb die Auswirkungen von Absprachen auf dem Markt durch die Vorinstanz zu untersuchen sind.”
Das Urteil hat zu heftigen und kritischen Reaktionen in der Lehre geführt; unter anderem zu nennen ist ein Beitrag eines ehemaligen Kollegen an unserer Universität im Jusletter. Aufgrund des Artikels sah sich ein Richter, der im Spruchkörper beider Entscheide Einsatz hatte, gar zu einer Replik veranlasst - ein relativ ungewöhnlicher Vorgang. Man würde daher erwarten, dass das Gericht im Fall BMW die Gelegenheit zur Klärung der entstandenen Kontroverse nutzen würde. Das gelingt dem Gericht aber nur insofern, als dass es seine zuerst geäusserte Meinung in den Zahnpastafällen bestätigt:
“Wenn das Gesetz bei ihrem Vorliegen die Vermutung statuiert, dass sie den wirksamen Wettbewerb beseitigen, so ist a maiore ad minus davon auszugehen, dass sie sich auch erheblich auf den Wettbewerb auswirken...”
“Das Bundesverwaltungsgericht stellt nach dem Gesagten fest, dass das in den Händlerverträgen der Beschwerdeführerin statuierte Exportverbot eine qualitativ erhebliche Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Damit handelt es sich, wie hiervor ausgeführt, auch insgesamt um eine den Wettbewerb erheblich beeinträchtigende Abrede.”
Das erhebliche Verwirrung stiftende Siegenia-Aubi Urteil wird in dieser Erwägung aber leider nicht diskutiert, sondern einfach ignoriert. Nur an anderer Stelle, bei der Auseinandersetzung mit den formellen Rügen, erfolgt eine Abgrenzung zu Siegenia. Damit bleibt weiterhin unklar, in welchen Zusammenhängen welches Erheblichkeitskonzept Anwendung finden kann. Das Gericht versäumt auch, sich grundsätzlich mit der Übertragbarkeit der Europarechts auf die schweizerische Kartellrechtsauslegung auseinanderzusetzen. So hat das Bundesgericht im Mobilterminierungsurteil i.S. Swisscom (BGE 137 II 199 E. 4.3) relativ deutlich die Auffassung geäussert, dass das schweizerische Kartellrecht grundsätzlich autonom und nicht parallel zum europäischen Recht auszulegen sei. Wie in früheren Urteilen setzt sich das Bundesverwaltungsgericht aber nicht mit den Argumenten des Bundesgerichts auseinander und macht dennoch vielfältige Bezüge zur europäischen Rechtspraxis. Insgesamt lässt das Gericht also eine weitere Gelegenheit zur Klärung dieser grundsätzlicher Fragen verstreichen. Zu hoffen ist, dass das Bundesgericht den Konflikt bei den hängigen Beschwerden in Sachen Gaba und Gebro aufgreift.
St.Gallen, 11. Dezember 2015